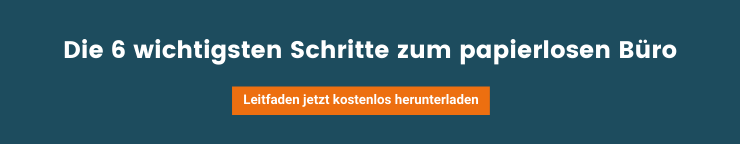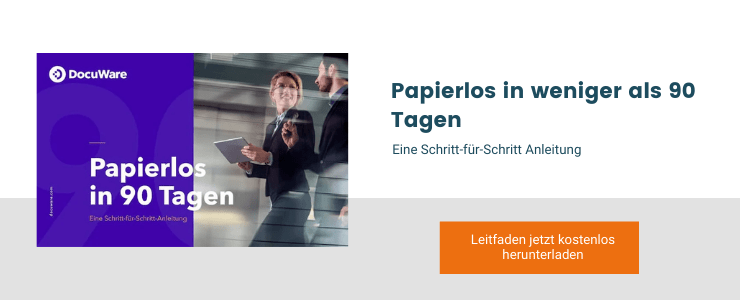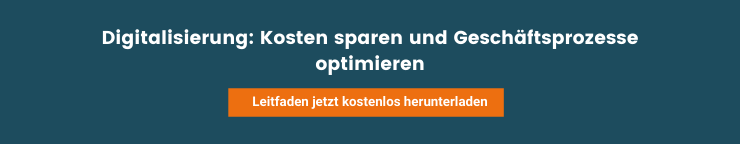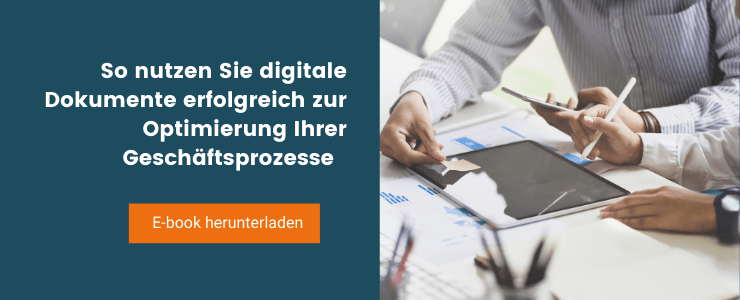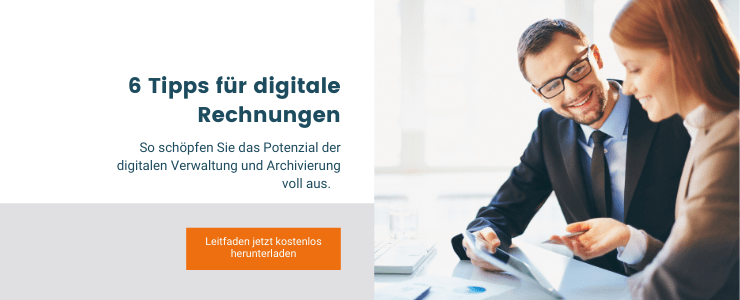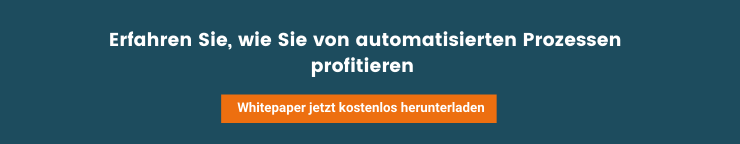Manche Dokumente wollen Unternehmer aufbewahren, andere müssen sie aufbewahren. Prospekte, Kataloge, Fotos oder Image-Broschüren können zur Dokumentation der Firmenhistorie dienen, Verträge, Rechnungen oder Zertifikate sollten so lange greifbar sein, wie sie benötigt werden bzw. der Gesetzgeber es vorschreibt. Das gilt ebenso für Entwicklungs- und Fertigungsunterlagen, wie Konstruktionszeichnungen, Rezepturen oder Qualitätsnachweise.
Auf immer und ewig?
Dabei stehen immer zwei Fragen im Raum: Wie lange müssen die Dokumente aufbewahrt werden – und wie lange will das Unternehmen sie behalten? Bei der Antwort gilt für Dokumente das Gleiche wie für Brautpaare. Die erhalten zur Hochzeit viele Glückwünsche unter dem Motto „auf immer und ewig“, obwohl alle wissen: Viele Ehen werden irgendwann geschieden, die Brautpaare gehen wieder getrennte Wege. Genauso trennen sich Unternehmen und Behörden im Laufe der Jahre von den allermeisten Dokumenten. Manche Dokumente müssen zwar einige Jahre, teilweise Jahrzehnte lang aufbewahrt werden. Viele werden aber nach und nach gelöscht, um Speicherkosten zu sparen und unnützen Informationsballast loszuwerden, der die Suche nach Dokumenten erschwert.
Man spricht bei dieser langjährigen Aufbewahrung der Dokumente von Langzeitarchivierung. Gemeint ist eine Vorrichtung, in der Aufbewahrenswertes zeitlich unbegrenzt untergebracht, zugänglich gemacht und erhalten wird. Hinzu kommt ein Management der Dokumente über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Vom Eingang in das Archiv über etwaige Änderungen und Ergänzungen oder das Weitergeben bis hin zur Vernichtung.
Langzeitarchivierung – was ist das?
Langzeitarchivierung dient dazu, Dokumente, Akten, Bücher, Fotografien oder Unterlagen von kulturellem, historischem, materiellem oder informellem Wert dauerhaft zu erhalten. Langzeitarchive finden sich unter anderem in Bibliotheken, Unternehmen und in der öffentlichen Verwaltung. Ihr Zweck ist es, das Archivgut nicht nur über Jahrzehnte aufzubewahren, sondern es auch zu schützen, zu erhalten und bei Bedarf jederzeit verfügbar zu machen.
Abschied vom Papier
In der Vergangenheit hat sich die Archivierung auf Papier bestens bewährt, denn es eignet sich auch hervorragend als Träger für Informationen, die rechtskonform und vor allem auch revisionssicher archiviert werden müssen. Wird säurefreies Papier richtig gelagert, kann es mehrere hundert Jahre überdauern.
Doch mittlerweile liegen immer mehr Daten nur noch in elektronischer Form vor: Steuerdokumente, Verträge, Entwicklungsunterlagen oder Umsatzstatistiken. Und an die Stelle des Briefes oder des Fax-Dokuments treten E-Mails und Messages. Deshalb ist längst elektronische Schriftgutverwaltung empfehlenswert. Also die sichere, unveränderbare Langzeitarchivierung von jederzeit wieder reproduzierbaren elektronischen Informationen und Dokumenten mit einer Archivierungssoftware. Optimalerweise mit einem Dokumentenmanagement-System (DMS).
Die Langzeitarchivierung mit dem DMS automatisiert den Prozess einer langfristigen Erfassung von Daten und Informationen, deren Aufbewahrung und der Bereitstellung der dauerhaften Verfügbarkeit. Dabei spielen drei Aspekte eine entscheidende Rolle, die bei der Aufbewahrung bzw. Archivierung von Dokumenten über kurze Zeiträume zu vernachlässigen sind:
- Der Inhalt muss lesbar sein,
- das Medium muss die Information bewahren und
- es muss diese zur Verfügung stellen können.
In diesem Zusammenhang lohnt sich die Rückbesinnung auf die Anfänge der Schrift: Die sumerische Keilschrift ist die ägyptischen Hieroglyphen. Damals sollten die Gesetze, die das alltägliche Leben und das Handeln miteinander regelten, eindeutig und dauerhaft festgelegt werden, so dass sie bei Streitigkeiten jederzeit zu Rate gezogen werden konnten.
Ohne digitale Transformation keine Transformation
Die Erfindung von Papyrus und Archivierung auf Papier (und später Mikrofilm) machte dann vieles im Sinne des Wortes leichter. Noch viel leichter wird die Langzeitarchivierung, wenn sie zeitgemäß elektronisch erfolgt. Denn ganz nebenbei legt die elektronische Archivierung auch den Grundstein für die Digitale Transformation, setzt sie doch voraus, dass Informationen digital abruf- und verarbeitbar sind. Das heißt: Ohne digitale Informationen keine Transformation.
Die Ursache ist offensichtlich: Abgelegt im physischen Ordner und verstaut im Schrank ist Papier zwar geduldig, aber nicht ein lebendiger Teil des digitalen Informationsflusses. Mit einem elektronischen Archivierungssystem dagegen werden Informationen über und aus Dokumenten in den digitalen Informationsfluss mit eingebracht. Die Langzeitarchivierung sorgt dann dafür, dass wirklich alle – auch sehr alte –Dokumente immer und überall abrufbar sind. So werden Dokumente dann zum integralen Bestandteil des digitalen Transformationsprozesses.
Damit der Zahn der Zeit nicht am Langzeitarchiv nagt, sind in Anbetracht der rasanten IT-Entwicklung einige wichtige Faktoren zu beachten. Sonst droht im Laufe der Jahre eine Sammlung veralteter Informationen bzw. von unverständlichem Informationsmüll zu entstehen. Denn unabhängig davon, aus welchem Grund ein Unternehmen oder eine Behörde Dokumente archiviert, ist der Prozess komplexer als es auf den ersten Blick scheint.
Langzeitarchivierung – aber richtig
Der erste Punkt, den es berücksichtigen gilt, ist das Speichermedium des Langzeitarchivs. Es kommt nur ein Medientyp in Betracht, der mindestens so lange lesbar ist, wie es die Aufbewahrungsfrist vorschreibt. Ein hochwertiges Magnetband sollte zehn Jahre oder länger halten; regelmäßiges Umspeichern kann ein Ausweg sein. Im Gegensatz dazu halten optische Speichermedien 30 bis 50 Jahre.
Auch das Speichersystem sollte überlegt ausgewählt sein. Früher wurden Archive gern auf Zip-Disketten gespeichert, weil die relativ preiswert waren und man – seinerzeit gigantische – 100 MB auf einer einzigen Diskette unterbringen konnte. Heute sind Zip-Disketten jedoch so gut wie ausgestorben – und es gibt kaum noch Laufwerke. Würde man ein altes finden, könnte man es nicht an den Rechner anschließen, denn wie die Zip-Laufwerke selbst sind auch die benötigten parallelen Anschlüsse am Rechner ausgestorben.
Leider lässt sich nicht vorhersagen, welche Arten von Speichermedien die Zeit überdauern werden. Dennoch ist es wichtig, sich bei der Langzeitarchivierung für die Geräte zu entscheiden, die die besten Chancen haben, langfristig unterstützt zu werden. Wie beim Magnetband kann Umspeichern eine Lösung sein, in dem Fall auf ein anderes Medium.
Regelmäßige Überarbeitung der Archive
Wie die verwendeten Speichersysteme werden sich im Laufe der Zeit auch die Archivierungsrichtlinien zweifellos ändern. Es empfiehlt sich daher, die Archive mindestens einmal im Jahr überprüfen. So lässt sich feststellen, ob etwas auf ein anderes Speichermedium migriert werden muss – und ob sich die Richtlinien und Aufbewahrungsfristen geändert haben.
Für Unternehmen ist die Langzeitarchivierung aus mehreren Gründen unverzichtbar. Zum einen erfordern gesetzliche Vorgaben wie das Handelsgesetzbuch, die Abgabenordnung (AO) und die Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen (GDPdU), dass Firmen Geschäftsdaten bis zu zehn Jahre lang aufbewahren. Diese Daten müssen Firmen Behörden, etwa dem Finanzamt, bei Bedarf umgehend und in einem maschinenlesbaren Format zur Verfügung stellen.
Eine Langzeitarchivierung von Daten bietet weiterhin die Möglichkeit, auf vorhandenes Know-how zurückzugreifen oder dieses bei Bedarf an Interessenten zu verkaufen (Verwertung von Patenten). Für öffentliche Einrichtungen wie Bibliotheken oder staatliche Archive ist die Langzeitarchivierung von Dokumenten die Grundlage ihrer Tätigkeit. Bei Geschäftsunterlagen beträgt der laut HGB und GOB vom Gesetzgeber vorgegebene Archivierungszeitraum bis zu zehn Jahre, bei Patientendaten sind es bis zu 30 Jahre.
Was unter Langzeitarchivierung fällt, ist Ansichtssache
Für Gebäudepläne, Katastereinträge und Unterlagen für medizinische Geräte gilt, dass sie über den gesamten „Lebenszeitraum“ der Objekte hinweg aufbewahrt werden müssen. Anderes Beispiel: Eine der zentralen Anforderungen an die Pharma- und Lebensmittelindustrie sowie die Reinraumüberwachung stellt die Langzeitarchivierung von Produktionsdaten gemäß nationalen und internationalen Anforderungen dar, wie beispielsweise GAMP5, FDA 21 CFR Part 11, VDI 2083 und DIN ISO 14644.
Drittes Beispiel: Aufbewahrungsfristen sind national geregelt. In den USA und in Frankreich sind die Aufbewahrungsfristen von Bankunterlagen von Kunden beispielsweise auf fünf Jahre beschränkt. In der Versicherungsbranche, bei Lebensversicherungen und Todesfallpolicen werden die Dokumente von dem Zeitpunkt des Abschlusses der Versicherung bis zu mehreren Jahren nach dem Tod des Kunden (mindestens fünf Jahre) aufbewahrt. Im Vereinigten Königreich werden Dokumente zum Rentenbezug 40 Jahre lang aufbewahrt, beginnend ab dem Tag der Unterschrift oder der Erneuerung des Vertrags durch den Kunden.
Die Langzeitarchivierung dient ganz nebenbei auch der Beweissicherung, beispielsweise im Rahmen eines Schadenersatzprozesses wegen angeblicher Konstruktionsfehler eines Produkts. Dann müssen auch noch nach Jahrzehnten die Originalunterlagen vorgelegt werden – also ist Revisionssicherheit gefragt; das bedeutet nebenbei bemerkt, dass auch die Verfahrensdokumentation archiviert werden muss.
Damit ein archiviertes elektronisches Dokument als Beweismittel zugelassen wird, ist es allerdings erforderlich, über kryptografisch signierte Dokumente den Beweiswert zu sichern und nötigenfalls zusammen mit den Metadaten, Signaturen und Beweissicherungen sogenannte „Evidence Records“ zu erstellen. Details dazu hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) in der Technischen Richtlinie (TR) 03125 festgelegt – und auch schon beweiswerterhaltende Langzeitarchivierungslösungen zertifiziert.
Fazit: Langzeitarchivierung macht sich nicht nebenbei
Aufbewahrungsfristen, ablaufende Speichermedien und die digitale Transformation machen Langzeitarchivierung zu einer Aufgabe, die immer wieder Aufmerksamkeit erfordert. Prüfen Sie Ihre Dokumente regelmäßig, damit aus dem Archiv keine Müllhalde wird!